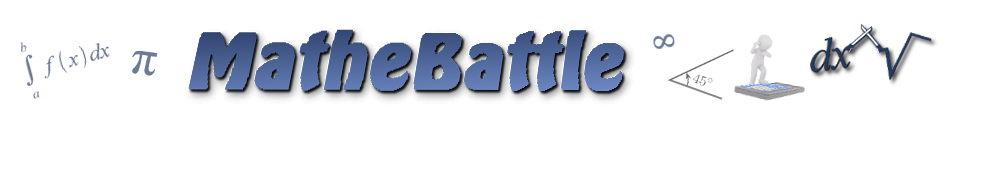Klasse 5-6
Klasse 5-6
 Klasse 7-8
Klasse 7-8
 Klasse 9-10
Klasse 9-10
 Kursstufe
Kursstufe
 cosh
cosh
nach Aufgabentypen suchen
Aufgabentypen anhand von Beispielen durchstöbern
Browserfenster aktualisieren (F5), um neue Beispiele bei den Aufgabentypen zu sehen
Binomialvert. mit variablem n (mind)
Beispiel:
Ein Lebensmittelhersteller wirbt damit, dass sich in jeder 7. Verpackung eine Überraschung befindet. Wie viele Packungen muss man mindestens kaufen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 60% mindestens 2 Überraschung(en) zu erhalten.
| n | P(X≤k) |
|---|---|
| ... | ... |
| 13 | 0.4269 |
| 14 | 0.3851 |
| ... | ... |
Die Zufallsgröße X gibt die Anzahl der Überraschungen an und ist im Idealfall binomialverteilt mit p = und variablem n.
Es muss gelten: ≥ 0.6
Weil man ja aber nicht in den WTR eingeben kann, müssen wir diese Wahrscheinlichkeit über die Gegenwahrscheinlichkeit berechnen:
= 1 - ≥ 0.6 |+ - 0.6
0.4 ≥ oder ≤ 0.4
Jetzt müssen wir eben so lange mit verschiedenen Werten von n probieren, bis diese Gleichung erstmals erfüllt wird:
Dabei stellt sich nun natürlich die Frage, mit welchem Wert für n wir dabei beginnen. Im Normalfall enden der Versuche mit einem Treffer.
Also müssten dann doch bei ≈ 14 Versuchen auch ungefähr 2
(≈
Wir berechnen also mit unserem ersten n=14:
Je nachdem, wie weit nun dieser Wert noch von den gesuchten 0.4 entfernt ist, erhöhen bzw. verkleinern wir das n eben in größeren oder kleineren Schrittweiten.
Dies wiederholen wir solange, bis wir zwei aufeinanderfolgende Werte von n gefunden haben, bei denen die 0.4 überschritten wird.
Aus der Werte-Tabelle (siehe links) erkennt man dann, dass erstmals bei n=14 die gesuchte Wahrscheinlichkeit unter 0.4 ist.
n muss also mindestens 14 sein, damit
Binomialvert. mit variablem n (mind)
Beispiel:
Die Firma Apple hat ein neues geniales Produkt, die iYacht, auf den Markt gebracht (wenn auch nicht ganz günstig). Die hierfür beauftragte Marketingagentur garantiert, dass unter denen, denen sie die Yacht vorgeführt hat, der Anteil der späteren Käufer bei 14% liegt. Wie vielen Personen muss nun dieses Produkt vorgeführt werden, damit sich mit mind. 50% Wahrscheinlichkeit, 26 oder mehr Käufer für dieses Produkt finden?
| n | P(X≤k) |
|---|---|
| ... | ... |
| 183 | 0.5001 |
| 184 | 0.4882 |
| 185 | 0.4764 |
| 186 | 0.4646 |
| ... | ... |
Die Zufallsgröße X gibt Anzahl der Käufer an und ist im Idealfall binomialverteilt mit p = 0.14 und variablem n.
Es muss gelten:
Weil man ja aber
0.5 ≥
Jetzt müssen wir eben so lange mit verschiedenen Werten von n probieren, bis diese Gleichung erstmals erfüllt wird:
Dabei stellt sich nun natürlich die Frage, mit welchem Wert für n wir dabei beginnen. Im Normalfall enden 14% der Versuche mit einem Treffer.
Also müssten dann doch bei
Wir berechnen also mit unserem ersten n=186:
Je nachdem, wie weit nun dieser Wert noch von den gesuchten 0.5 entfernt ist, erhöhen bzw. verkleinern wir das n eben in größeren oder kleineren Schrittweiten.
Dies wiederholen wir solange, bis wir zwei aufeinanderfolgende Werte von n gefunden haben, bei denen die 0.5 überschritten wird.
Aus der Werte-Tabelle (siehe links) erkennt man dann, dass erstmals bei n=184 die gesuchte Wahrscheinlichkeit unter 0.5 ist.
n muss also mindestens 184 sein, damit
Binomialvert. mit variablem n (höchst.)
Beispiel:
In einer Urne ist der Anteil der grünen Kugeln 85%. Wie oft darf höchstens gezogen werden ( - natürlich mit Zurücklegen - ), so dass mit mind. 70% Wahrscheinlichkeit nicht mehr als 39 grüne Kugeln gezogen werden?
| n | P(X≤k) |
|---|---|
| ... | ... |
| 44 | 0.8097 |
| 45 | 0.6858 |
| 46 | 0.5464 |
| ... | ... |
Die Zufallsgröße X gibt Anzahl der gezogenen grünen Kugeln an und ist im Idealfall binomialverteilt mit p = 0.85 und variablem n.
Es muss gelten:
Jetzt müssen wir eben so lange mit verschiedenen Werten von n probieren, bis diese Gleichung erstmals erfüllt wird:
Dabei stellt sich nun natürlich die Frage, mit welchem Wert für n wir dabei beginnen. Im Normalfall enden 85% der Versuche mit einem Treffer.
Also müssten dann doch bei
Wir berechnen also mit unserem ersten n=46:
Je nachdem, wie weit nun dieser Wert noch von den gesuchten 0.7 entfernt ist, erhöhen bzw. verkleinern wir das n eben in größeren oder kleineren Schrittweiten.
Dies wiederholen wir solange, bis wir zwei aufeinanderfolgende Werte von n gefunden haben, bei denen die 0.7 überschritten wird.
Aus der Werte-Tabelle (siehe links) erkennt man dann, dass letztmals bei n=44 die gesuchte Wahrscheinlichkeit über 70% ist.
Binomialvert. mit variablem p (diskret) für WTR
Beispiel:
Eine Firma, die Überraschungseier vertreibt, möchte als Werbegag manche Eier mit Superfiguren bestücken. Aus Angst vor Kundenbeschwerden sollen in einer 11er-Packung mit der mindestens 50% Wahrscheinlichkeit 2 oder mehr Superfiguren enthalten sein. Wenn in jedes n-te Ei eine Superfigur rein soll, wie groß darf dann n höchstens sein?
| p | P(X≥2)=1-P(X≤1) |
|---|---|
| ... | ... |
| 0.9941 | |
| 0.9249 | |
| 0.8029 | |
| 0.6779 | |
| 0.5693 | |
| 0.4801 | |
| ... | ... |
Die Zufallsgröße X gibt die Anzahl der Eier mit einer Superfigur an. X ist binomialverteilt mit n=11 und unbekanntem Parameter p.
Es muss gelten:
Wir wissen, dass der Zähler bei unserer Einzelwahrscheinlichkeit p 1 sein muss, da es ja genau einen günstigen Fall gibt.
Wir müssen nun bei verschiedenen Nennern untersuchen, wie hoch die gesuchte Wahrscheinlichkeit
Als Startwert wählen wir als p=
In dieser Tabelle erkennen wir, dass letztmals bei der Einzelwahrscheinlichkeit p=
Der Nenner, also die das wievielte Ei eine Superfigur enthält, darf also höchstens
6 sein.
Binomialvert. mit variablem k (mind.)
Beispiel:
Bei einem Multiple-Choice-Test werden 35 Fragen gestellt. Bei jeder Frage gibt es 4 Antworten, von denen genau eine richtig ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit reinem Raten der richtigen Antworten durch Zufall trotzdem den Test besteht, soll unter 2% liegen. Wie viele Fragen müssen dann zum Bestehen des Tests mindestens richtig beantwortet werden?
| k | P(X≤k) |
|---|---|
| ... | ... |
| 9 | 0.6263 |
| 10 | 0.7581 |
| 11 | 0.8579 |
| 12 | 0.9244 |
| 13 | 0.9637 |
| 14 | 0.9842 |
| 15 | 0.9938 |
| 16 | 0.9978 |
| 17 | 0.9993 |
| 18 | 0.9998 |
| ... | ... |
Die Zufallsgröße X gibt die Anzahl der richtig geratenen Fragen an und ist im Idealfall binomialverteilt mit p =
Es muss gelten:
oder andersrum ausgedrückt:
Jetzt müssen wir eben so lange mit verschiedenen Werten von k probieren, bis diese Gleichung erstmals erfüllt wird:
Dabei kann man entweder einfach viele verschiedene Werte einzeln berechnen oder man verwendet Listen bei der Binomialverteilung im WTR, (TI: binomcdf, Casio: Kumul. Binomial-V).
Schaut man dazu die kumulierte Binomialverteilung in der Tabelle links an, so erkennt man, dass die Trefferzahlen im Intervall zwischen 0 und
13 immer noch weniger als 0.98 der Gesamt-Wahrscheinlichkeit auf sich vereinen. Erst
Das kleinstmögliche k mit
Die Mindestanzahl richtiger Fragen zum Bestehen des Tests muss somit k = 15 sein.
(also keine kumulierte Wahrscheinlichkeit wie links in der Tabelle)
Binomialvert. mit variablem k (mind.)
Beispiel:
Bei einer Wurfbude ist die Wahrscheinlichkeit einen Ball in einen Eimer zu treffen bei ca. 10%. Für einen bestimmten Betrag darf man 12 mal werfen. Wenn man dabei eine bestimmte Mindestanzahl von Treffern k erzielt, bekommt man einen Hauptpreis. Wie hoch muss man k mindestens setzen, damit der Hauptpreis nur mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 12% ausgegeben werden muss?
| k | P(X≤k) |
|---|---|
| 0 | 0.2824 |
| 1 | 0.659 |
| 2 | 0.8891 |
| 3 | 0.9744 |
| 4 | 0.9957 |
| 5 | 0.9995 |
| 6 | 0.9999 |
| ... | ... |
Die Zufallsgröße X gibt die Anzahl der getroffenenen Bälle an und ist im Idealfall binomialverteilt mit p = 0.1 und n = 12.
Es muss gelten:
oder andersrum ausgedrückt:
Jetzt müssen wir eben so lange mit verschiedenen Werten von k probieren, bis diese Gleichung erstmals erfüllt wird:
Dabei kann man entweder einfach viele verschiedene Werte einzeln berechnen oder man verwendet Listen bei der Binomialverteilung im WTR, (TI: binomcdf, Casio: Kumul. Binomial-V).
Schaut man dazu die kumulierte Binomialverteilung in der Tabelle links an, so erkennt man, dass die Trefferzahlen im Intervall zwischen 0 und
1 immer noch weniger als 0.88 der Gesamt-Wahrscheinlichkeit auf sich vereinen. Erst
Das kleinstmögliche k mit
Die Mindestanzahl der getroffenenen Bälle muss somit k = 3 sein.
(also keine kumulierte Wahrscheinlichkeit wie links in der Tabelle)
Binomialvert. mit variablem k (höchst.)
Beispiel:
Bei einem Zufallsexperiment beträgt die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer p=0,7. Das Zufallsexperiment soll 84 mal wiederholt werden. Dabei soll die Wahrscheinlichkeit, dass von den 84 Versuchen höchstens k Treffer sind, weniger als 80% betragen. Bestimme den größtmöglichen Wert für k.
| k | P(X≤k) |
|---|---|
| ... | ... |
| 56 | 0.2883 |
| 57 | 0.3731 |
| 58 | 0.4652 |
| 59 | 0.56 |
| 60 | 0.6521 |
| 61 | 0.7366 |
| 62 | 0.8098 |
| 63 | 0.8695 |
| 64 | 0.9151 |
| 65 | 0.9479 |
| ... | ... |
Die Zufallsgröße X gibt Anzahl der Treffer an und ist im Idealfall binomialverteilt mit p = 0.7 und n = 84.
Es muss gelten:
Jetzt müssen wir eben so lange mit verschiedenen Werten von k probieren, bis diese Gleichung erstmals nicht mehr erfüllt wird:
Dabei kann man entweder einfach viele verschiedene Werte einzeln berechnen oder man verwendet Listen bei der Binomialverteilung im WTR, (TI: binomcdf, Casio: Kumul. Binomial-V).
Schaut man dazu die kumulierte Binomialverteilung in der Tabelle links an, so erkennt man, dass die Trefferzahlen im Intervall zwischen 0 und
61 immer noch weniger als 0.8 der Gesamt-Wahrscheinlichkeit auf sich vereinen. Erst
Das größtmögliche k mit
größtmöglicher Wert für k muss somit k = 61 sein.
(also keine kumulierte Wahrscheinlichkeit wie links in der Tabelle)